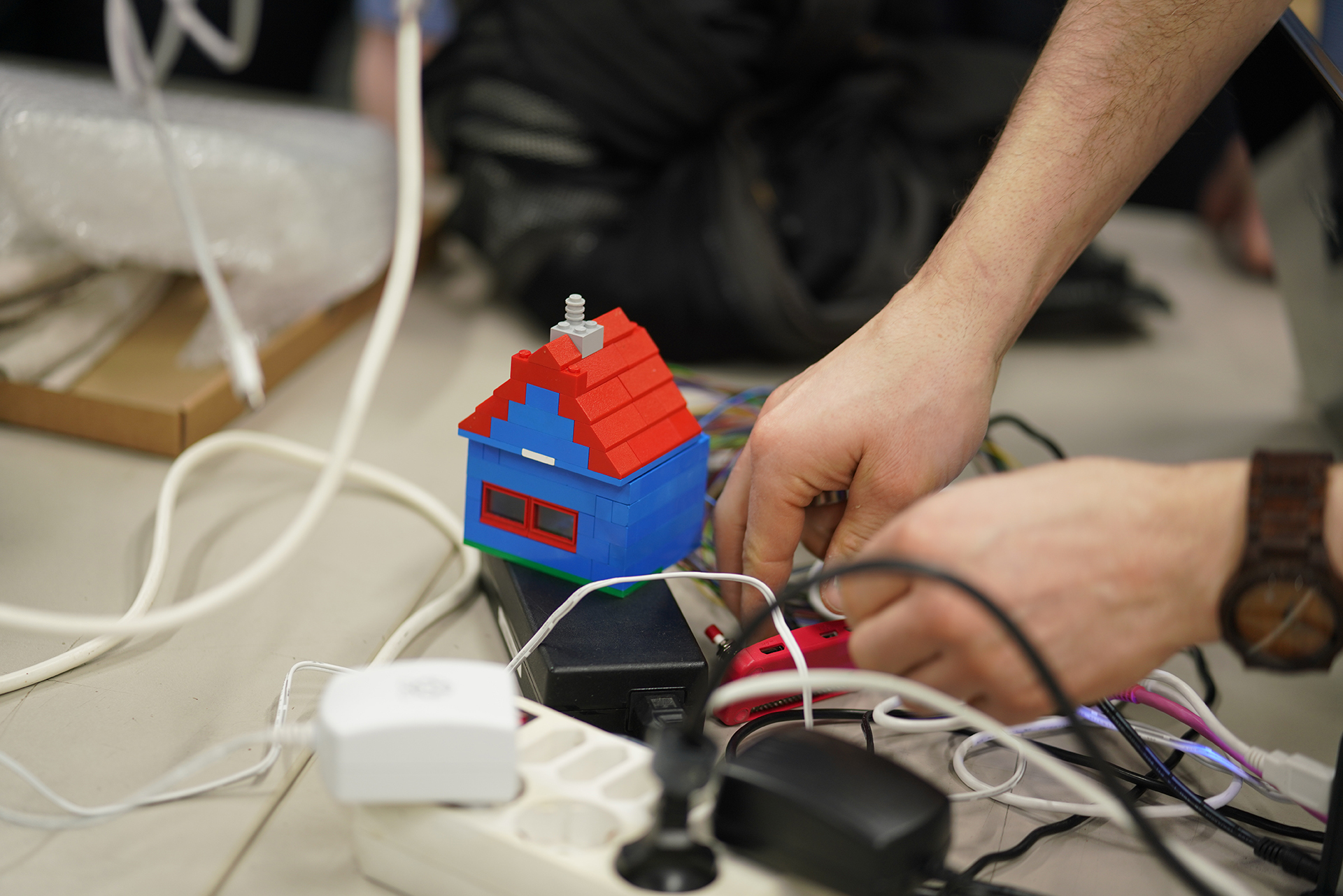Genau mit dieser Frage habe ich mich in den letzten Monaten im Rahmen meiner Bachelorarbeit als Praktikantin im Hafven Impact Accelerator beschäftigt. Obwohl auf europäischer Ebene viel über Kollaboration gesprochen wird – etwa im Rahmen des EU-Programms „Startup Europe“, das gezielt auf die Förderung von Startup-KMU-Partnerschaften ausgerichtet ist – zeigt sich im Alltag ein anderes Bild: Die tatsächliche Zusammenarbeit bleibt oft aus.
Viele Startups und KMU arbeiten entweder gar nicht zusammen oder erkennen nicht den Mehrwert einer Kooperation. Manche fürchten den organisatorischen Aufwand, andere sehen keine Überschneidung in ihren Zielen. Dabei entgehen ihnen enorme Chancen: Startups bringen frische Ideen, Innovationskraft und neue Arbeitsansätze ein, während KMU Zugang zu etablierten Märkten, Netzwerken und Produktionsressourcen bieten. Beide Seiten könnten voneinander profitieren – doch in der Praxis fehlt häufig ein gemeinsames Fundament.
Ein zentrales Hindernis, das ich identifiziert habe, ist der fehlende gemeinsame Kontext. Startups müssen sich nicht nur im eigenen Ökosystem behaupten, sondern aktiv in die Branchen eintauchen, in denen potenzielle KMU-Partner tätig sind. Das bedeutet, relevante Netzwerke aufzubauen, an Branchenevents teilzunehmen und sich in bestehenden Communities zu engagieren. Nur so lassen sich Anknüpfungspunkte schaffen und reale Bedürfnisse identifizieren, an denen die eigenen Ideen ausgerichtet werden müssen. Eine gezielte Präsenz an Orten, an denen KMU aktiv sind – statt sich nicht nur auf typischen Startup-Veranstaltungen zu tummeln – ist entscheidend, um Berührungspunkte und Vertrauen mit KMU’s aufzubauen.
Doch auch die Kommunikation stellt eine große Herausforderung dar. Für eine erfolgreiche Kooperation braucht es mehr als gute Ideen: Ehrlichkeit, Klarheit und Verlässlichkeit sind essentiell. Da beide Seiten meist mit begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen arbeiten, müssen Anfragen gut vorbereitet, transparent und konkret formuliert sein – insbesondere im Hinblick auf Zeitpläne, Fähigkeiten und Preise. Nur so lassen sich Erwartungen klären und Missverständnisse vermeiden. Gleichzeitig ist eine offene Feedbackkultur notwendig, die Raum für Fragen lässt, sich auf das gemeinsame Problem und Ziel konzentriert und laufend zur selbst reflektierten Verbesserung der Kommunikation beiträgt.
Nicht zuletzt spielen strukturierte Prozesse eine zentrale Rolle. Damit eine Zusammenarbeit nicht im Chaos endet, braucht es klare Zuständigkeiten, regelmäßige Meetings und technische Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Informationsaustausch. Auch Konflikte sollten nicht gescheut, sondern offen und lösungsorientiert angesprochen werden – immer mit Fokus auf das Problem, nicht auf Schuldzuweisungen. Eine transparente Dokumentation aller Absprachen stellt zudem sicher, dass Fortschritte nachvollziehbar bleiben und Vertrauen langfristig aufgebaut wird.
Obwohl diese Punkte simpel erscheinen mögen, werden sie im Alltag oft übersehen. Doch wer sie konsequent umsetzt, schafft die Grundlage für nachhaltige, erfolgreiche Kooperationen. Denn genau darin liegt der Schlüssel: Ein gemeinsamer Kontext, klare Kommunikation und strukturierte Prozesse eröffnen Startups und KMU neue Möglichkeiten für Innovation, Wachstum und gemeinsames Lernen.
Von Denise Kästner